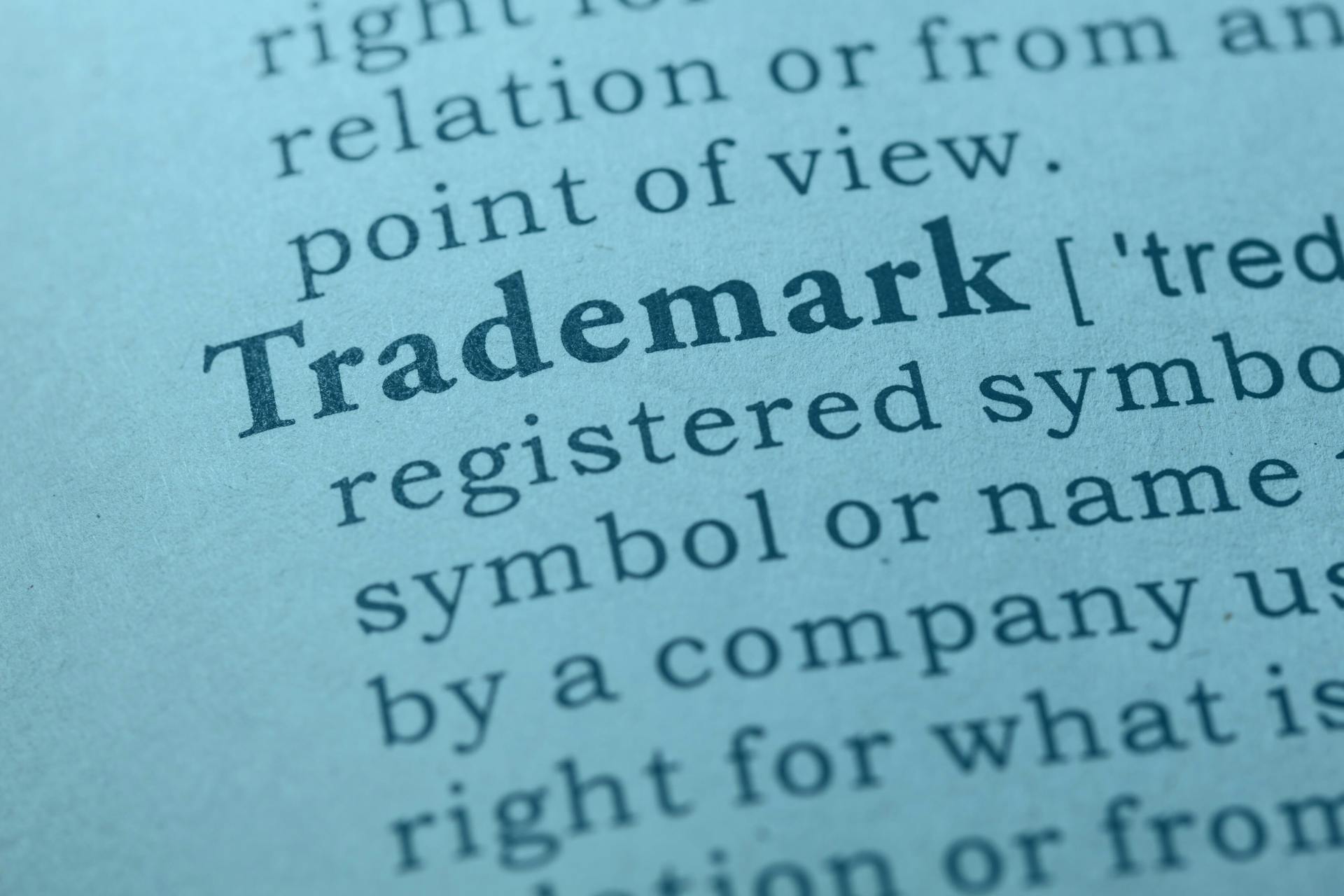
With the ruling SkyKick vs Sky (C-371/18) the CJEU creates more legal certainty: The lack of an intention to use the trademark at the time of filing does not in itself constitute bad faith in the trademark application. Thus, European trademark law differs from US trademark law in another important aspect. Even after the CJEU ruling, the strict requirement that goods and services for which protection is sought must be specified precisely and unambiguously still applies. More on this topic here.